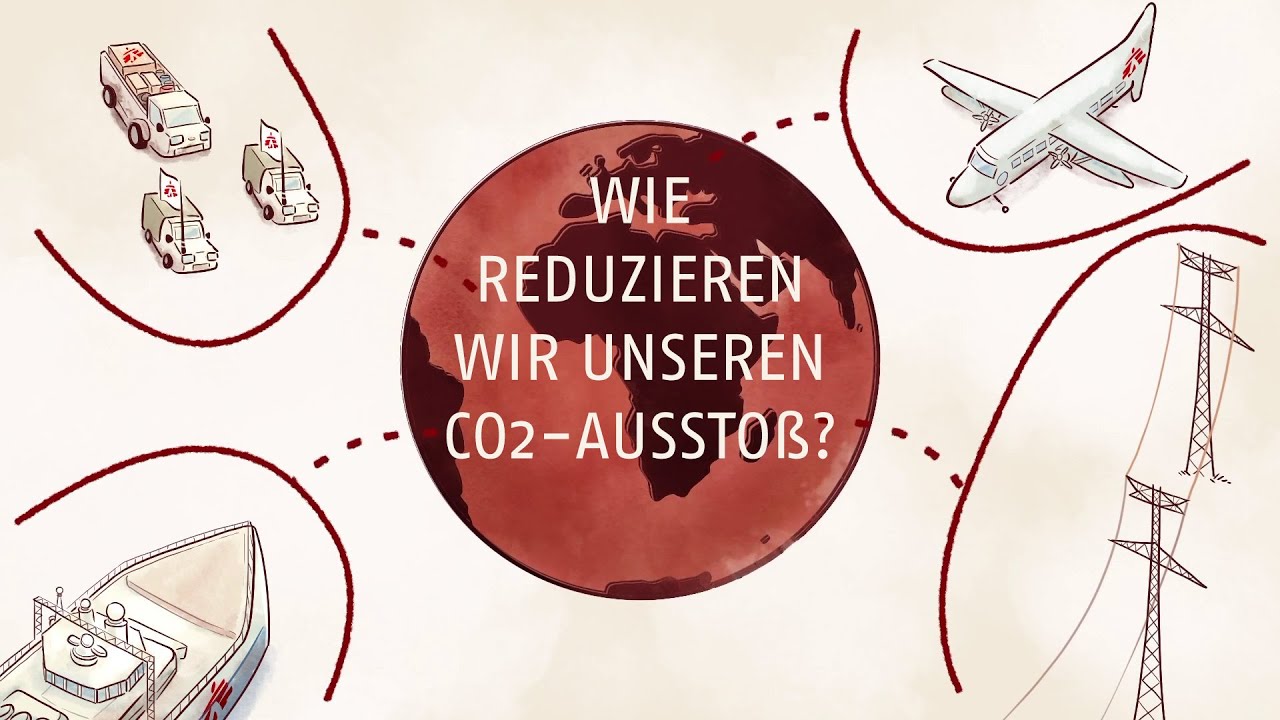Die Charta für das Klima: Bewegung präsentiert drei Forderungen

Leider ist es keine Einbildung, sondern die bittere Realität. Die globale Erderwärmung ist der Anstieg der Durchschnittstemperatur der Erdatmosphäre und Ozeane, wobei die aktuelle Erwärmung in großen Teilen menschengemacht ist. Ein hoher Ausstoß von Treibhausgasen in den letzten einhundert Jahren hat diesen Prozess beschleunigt, was auch noch einige Jahre so weitergehen wird.
Der Handlungsbedarf ist hoch und die Frage ist nicht mehr, ob das Problem gelöst werden muss, sondern wie das geschehen soll. Das weiß auch die Bewegung “Klimastreik Schweiz”, die im Zuge der Schweizer Parlamentswahlen 2019 eine Klima-Charta aufgestellt hat, die sie den Politikern und Parteien präsentiert, damit diese dazu Stellung nehmen und ihre eigenen Positionen erläutern können. In drei Forderungen wird dargelegt, was sich ändern muss, um die globale Erwärmung frühzeitig zu senken. Die Klima Charta im Detail wird in diesem Artikel vorgestellt.
Die Charta der Klima-Bewegung
Wenn von einer Charta die Rede ist, dann ist damit eine Art Gründungsdokument oder auch eine Satzung zu verstehen, in denen Selbstverpflichtungen zu finden sind. Geht es nach der Bewegung “Klimastreik Schweiz” müssen sich die Politiker und der Staat zu bestimmten Grundsätzen bekennen, um damit der globalen Klimaerwärmung zu begegnen.
Ausruf des Klimanotstands
Die erste Forderung der Klima Charta besteht in der Ausrufung des Klimanotstands. Damit soll die Schweiz die Klimakatastrophe als Krise anerkennen, die bewältigt werden kann. Dabei betonen die Verfasser, dass es dabei nicht um eine Krisensituation geht, in deren Folge demokratische Rechte eingeschränkt werden sollen, sondern darum, eine inhaltliche Priorisierung zu erreichen.
Das bedeutet, dass wissenschaftliche Berichte, unter anderem des Weltklimarats (IPCC), ernst genommen werden müssen. Ferner gilt es, die Bevölkerung ehrlich und transparent zu informieren, sodass diese sich konstruktiv an den Diskussionen über Lösungsansätze beteiligen kann. Unterm Strich gilt, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen und die Anerkennung der Situation ist der erste wichtige Schritt.
Netto-Null-Emissionen bis 2030
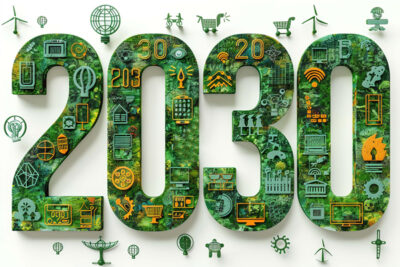
In diesem Prinzip geht es um die gemeinsame Verantwortung aller Länder, allerdings wird berücksichtigt, dass jede Nation ihre eigenen Umstände und Fähigkeiten hat. Dadurch kommt Industrieländern eine größere Rolle zu, da sie nicht nur technologisch besser aufgestellt sind, sondern auch einen höheren Anteil an den Emissionen tragen.
Klimagerechtigkeit

Heutige Probleme und Aufgaben dürfen nicht auf zukünftige Generationen abgewälzt werden. Dieser Punkt ist enorm wichtig, da schon in den letzten Jahren eine Spaltung der Gesellschaft zu erkennen war.
Die Zusatzklausel

Was genau ein Systemwandel beinhalten könnte, wurde nicht definiert und bewusst offen gelassen. Ein solcher Wandel muss von der gesamten Gesellschaft erarbeitet und getragen werden. Dabei geht es nicht nur um technische oder wirtschaftliche Veränderungen, sondern auch um eine Anpassung politischer Prioritäten und gesellschaftlicher Werte.
Die globale Erderwärmung und das 2-Grad-Ziel
Schon Anfang des letzten Jahrhunderts war bekannt, dass Treibhausgase einen Effekt für die Klimaerwärmung haben. Seit 1950 nehmen die Veränderungen des globalen Klimasystems in hohem Tempo zu, sodass mittlerweile schon die Folgen des Klimawandels zu spüren sind. Bereits jetzt liegt die globale Durchschnittstemperatur bei rund 1,2 Grad über dem vorindustriellen Stand. Berechnungen und Schätzungen zeigen, dass bis Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung von 2,5 bis 2,9 Grad erreicht werden kann, was drastische Folgen nach sich ziehen würde. Daher gab es 2015 das Pariser Klimaabkommen, bei dem sich der größte Teil aller Staaten der Welt auf eine globale Temperaturgrenze geeinigt hat.

Es müssen in den 2020er Jahren vor allem in den Industrienationen große Änderungen durchgeführt werden, wenn der Emissionsausstoß bis 2025 auf Null sinken soll. Technologisch gibt es durchaus Möglichkeiten, doch leider scheitern viele Vorhaben am Willen zum Systemwandel und der politischen Umsetzungsgeschwindigkeit. Teilweise dafür verantwortlich ist auch die Abkopplung von Ursache und Wirkung. Viele Menschen nehmen die Klimaerwärmung immer noch nicht als drängendes Problem wahr und verorten die Schwierigkeiten vor allem in der Zukunft. Dabei ist längst klar, dass es ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, an dem sich der größte Teil der Menschen beteiligen muss.
Was der Einzelne tun kann
Klar ist, der Einzelne alleine kann gegen die globale Klimaerwärmung gar nichts ausrichten. Allerdings ist der Einzelne nicht alleine, sodass sich Entscheidungen doch kumulieren und jeder seinen Beitrag leisten kann. Dabei geht es nicht nur um konkrete Maßnahmen, sondern auch um ein gesellschaftliches Klima und die Fürsprache für den Wandel. Das kann schon dabei beginnen, dass Menschen nicht diskreditiert werden, die sich für Veränderungen und Klimaschutz einsetzen, selbst wenn man nicht immer einer Meinung mit diesen sein sollte. Wer selbst in seinem Alltag und Leben Dinge anders machen möchte, um durch Wissen die eigene CO2-Bilanz aufzubessern, kann an zahlreichen Punkten ansetzen.
Die ganz großen Posten sind Reisen. Fliegen ist eine super Möglichkeit, um die CO 2-Bilanz in wenigen Stunden ins Unermessliche zu treiben. Wenn es also möglich ist, sollte man auf Fliegen verzichten und lieber den Zug nehmen. Auch das Auto kann häufiger mal stehen bleiben. Oft können kurze Strecken auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad überwunden werden. Der Bäcker nebenan wird am besten mit einem Spaziergang verbunden. Über die Mobilität hinaus sind Ernährung und Konsum wichtige Faktoren. Eine pflanzenbasierte Ernährung ist nachweislich ein sehr wirksamer Hebel für die Bilanz des CO2-Ausstoßes. Auch saisonale und regionale Einkäufe können hier eine Verbesserung bringen.
Weitere Möglichkeiten sind Ökostrom beziehen und die Heizkosten senken, was einfach geht, wenn die Raumtemperatur nur um einen Grad gesenkt wird. Geräte, die nicht gebraucht werden, müssen auch nicht im Standby stehen, da auch dieser Modus Strom verbraucht. Politisch kann der Klimawandel in die Wahlentscheidung mit einfließen, ebenso auch im Diskurs und in Gesprächen mit Freunden und Familie. Es geht nicht darum, dass der Einzelne alles ändert und sein Leben komplett umkrempelt. Aber jeder kann schauen, ob es Stellschrauben im Leben gibt, an denen ohne große Umstellungen gedreht werden kann. Es geht um die Zukunft der Welt und der zukünftigen Generationen.
Fazit zur Charta für das Klima
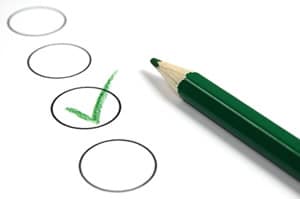
Es müssen große Anstrengungen unternommen werden, was für den Einzelnen ebenso gilt wie für Unternehmen und Länder. In einer Charta hat die Bewegung “Klimastreik Schweiz” drei Forderungen aufgestellt, die für die Schweizer Politik bindend sein sollen. Diese drei Forderungen lauten: Ausrufung des Klimanotstands, Netto-Null-Emissionen bis 2030 im Inland und Klimagerechtigkeit. In einer Zusatzklausel wird ein Systemwandel eingebracht, der notfalls für diese Ziele erfolgen muss.